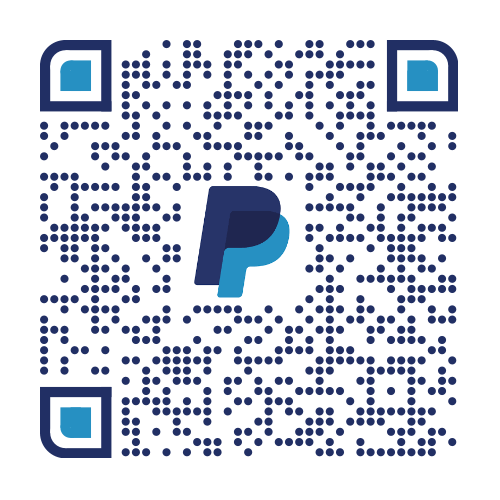Sehen die Gehirne von Autisten anders aus?
Inhaltsverzeichnis
Human Connectome-Projekt
Seit Juli 2009 arbeiten Wissenschaftler am Human Connectome-Projekt . Ziel des Projekts ist das Erstellen einer neuronale Netzwerkkarte. Eine Karte welche alle Verbindungen im Gehirn eines Menschen abbildet. Viele dieser Verbindungen werden durch die Erfahrungen welche wir in unserem leben machen verstärkt. Zusammen bilden sie unsere Erinnerungen, unsere Persönlichkeit und unsere Fähigkeiten.

Diffusions-MRT des menschlichen Gehirns. (Bildquelle: Human Connectome Project)
Das Ziel des Projektes ist es, ein besseres Verständnis der anatomischen und funktionellen Konnektivität des menschlichen Gehirns zu bekommen und eine Datenkarte zu erhalten, welche die Erforschung von Krankheiten wie Legasthenie, Schizophrenie , Alzheimer-Krankheit und Autismus erlaubt. Wobei Autismus keine Krankheit, sondern eine Wesensart ist.
Konnektivität bei Autismus
Während die Forschung zur Gehirnkonnektivität bei Autismus widersprüchlich war und in einigen Studien sowohl Hypokonnektivität (dh fehlende Verbindungen) als auch Hyperkonnektivität (sehr viele Verbindungen) erkannten, hat die Connectome-Forschung diesen offensichtlichen Widerspruch gelöst, indem sie gezeigt hat, dass bestimmte Hirnregionen bei Autisten eine hohe Interkonnektivität und bei Neurotypen eine vergleichsweise reduzierte Konnektivität aufweisen, während andere Hirnregionen bei Autisten eine geringere Konnektivität- und bei Neurotypen eine vergleichsweise hohe Konnektivität aufweisen.
Die Analyse von fMRI-Scans zwischen Autisten und Nicht-Autisten zeigten in bestimmte Regionen des Gehirns eine hohe interhemisphärische Konnektivität (zwischen der rechten und der linken Seite) auf. Zum Beispiel in den primäre sensorisch-motorische Regionen wie dem sensomotorische Kortex oder dem okzipitale Kortex .
Andere Regionen hingegen zeigten eine geringe interhemisphärische Konnektivität auf. Zum Beispiel beim präfrontale Kortex oder dem temporale Kortex.
Frontalkortex
Untersuchungen aus dem Jahr 2005 zeigen bei Autisten auf, dass die Konnektivität innerhalb des Frontallappens übermässig, unorganisiert und unzureichend selektiv ist und die Konnektivität zwischen dem präfrontalen Kortex und anderen Systemen schlecht synchronisiert und schwach reagierend ist
Aufgrund dieser lokalen Überkonnektivität und der verringerten kortikalen Fernaktivität treten bei folgenden Bereichen Beeinträchtigungen auf:
- Soziale und emotionale Verarbeitung und Kommunikation
- Kognitive Funktionen
- Sprechen
Untersuchungen aus dem Jahr 2008 weisen auf abnormale Muster effektiver Konnektivität hin, wobei der präfrontale Kortex eine Schlüsselstelle für Funktionsstörungen bei effektiver Konnektivität darstellt. Nach diesen Erkenntnissen könnte eine abnormal langfristige Konnektivität zwischen den Strukturen des «sozialen Gehirns» die sozio-emotionalen Herausforderungen erklären, welche Autismus charakterisieren.
Funktionale Konnektivität
Die Erforschung der Konnektivität derselben Gehirnregionen kann durchaus widersprüchlich sein. Einige Studien weisen darauf hin, dass die funktionelle Konnektivität (die Konnektivität zwischen Hirnregionen, die gemeinsame, funktionelle Eigenschaften haben) in bestimmten Hirnregionen bei autistischen Personen schwächer ist, was zu kortikalen Fern-Konnektivitätstheorien über Autismus führt. Neue Erkenntnisse stellen jedoch die Unterkonnektivitätsmodelle in Frage und weisen stattdessen darauf hin, dass in autistischen Gehirnen die funktionelle Konnektivität zwischen Gehirnregionen versteckt sein könnte.Ein Papier aus dem Jahr 2013 zeigt auf, dass die unterschiedlichen Ergebnisse darauf zurückzuführen sind, dass sich die Probanden in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Studien an autistischen Kindern unter 12 Jahren (vor der Pubertät) erkennen erhebliche Hinweise auf eine funktionelle Hyperkonnektivität, während Studien an autistischen Jugendlichen und Erwachsenen auf eine funktionelle Hypokonnektivität hinweisen.

Schematisches Modell zweier Szenarien, welche bei Autismus eine Verschiebung der Entwicklung von intrinsischer Hyper- zu Hypokonnektivität erklären könnten (Bildattribution: Uddin et al.)
Das obige Diagramm zeigt zwei mögliche Szenarien, wie sich die funktionale Konnektivität mit dem Alter entwickelt:
- In Szenario 1 (durchgezogene blaue Linie) zeigt die Autismusgruppe im Vergleich zur TD-Gruppe einen weniger steilen Anstieg der funktionellen Konnektivität über die Altersspannen hinweg.
- In Szenario 2 (gestrichelte blaue Linie) zeigt die Autismusgruppe anomale Konnektivitätsmuster in der Pubertätsperiode.
Idiosynkratische Gehirne
Wenn Forscher nicht-autistische Gehirnscans übereinander legten, waren sich alle Gehirne sehr ähnlich. Als jedoch bei autistischen Gehirnscans dasselbe getan wurde, waren die autistischen Gehirne alle sehr unterschiedlich. Die autistischen Gehirne hatten jeweils Bereiche mit hoher und niedriger Konnektivität.
Mit anderen Worten, autistische Menschen haben individuellere , eigenwilligere Konnektivitätsmuster als die Kontrollpersonen, welche keine Autisten waren. Jedes autistische Gehirn unterschied sich von der Norm, aber jedes tat es auf seine eigene Weise.
In der folgenden Abbildung sieht man, wie die Konnektivität autistischer Personen und Kontrollen verglichen wurde. Man beachte die höhere Ähnlichkeit zwischen den Subjekten bei den Teilnehmern der Nicht-Autisten im Vergleich zu denen der Autismusgruppe.

Idiosynkratische Verzerrungen heterotopischer interhemisphärischer Konnektivitätsmuster in Autismusgruppen. Ähnlichkeitsmatrizen werden für die Kontrollgruppe (links) und die Autismusgruppe (rechts) dargestellt und nach absteigenden mittleren Ähnlichkeitswerten geordnet. (Bildzuschreibung: Hahamy et al.)
Diese Ergebnisse legen nahe, dass Autismus möglicherweise eher auf die Art und Weise zurückzuführen ist, in der Bestandteile des autistischen Gehirns miteinander zusammenhängen, als insbesondere auf Hypo- / Hyperkonnektivität.
Konnektivität und Symptomatik
Die Forschungsergebnisse zeigen auch, dass die Defizite / Merkmale, welche Autismus in den Kernbereichen Kommunikation , soziales und stereotypes Verhalten charakterisieren mit den Veränderungen der Konnektivität korrelieren.

Quantifizierung individueller Musterverzerrungen und Korrelation bei Autismus-Merkmale. (Bildzuschreibung: Hahamy et al.)
Es scheint also, dass autistische Gehirne zueinander unterschiedlich, aber gegenüber einem neurotypischen Gehirn immer anders sind. Es ist davon auszugehen, dass diese Unterschiede dafür verantwortlich sind, dass Autisten mit der Welt unterschiedlich korrespondieren.